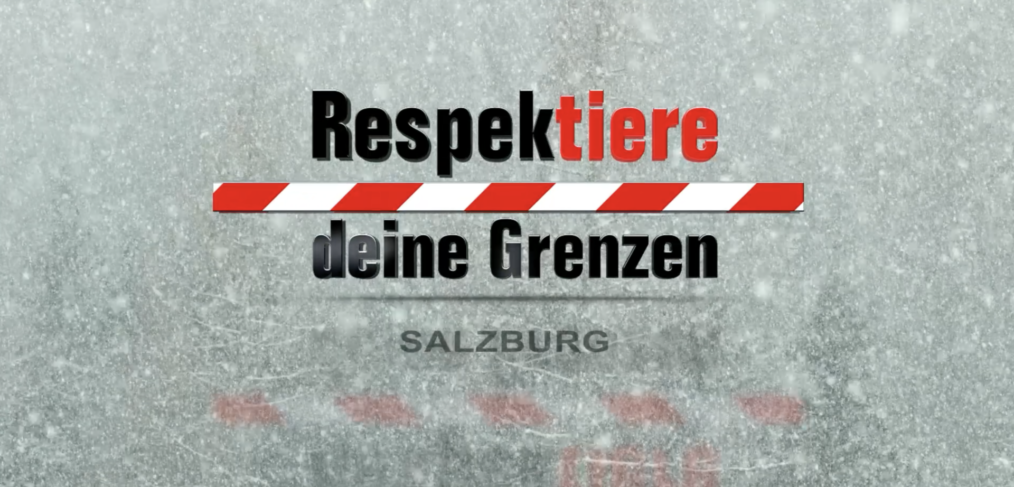Die Abgabe des unter Jägerinnen und Jägern anerkannten Trophäen-Bleichmittels Wasserstoffperoxid, wurde mit 1. Februar 2021 durch eine neue EU-Verordnung von einem Registrierungssystem auf ein neues Genehmigungssystems umgestellt.
JAGD ÖSTERREICH erreichte nun eine Einstufung der Verwendung von Wasserstoffperoxid als gewerbliche Tätigkeit für alle Jägerinnen und Jäger.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie konnte JAGD ÖSTERREICH eine einheitliche Lösung für die 130.000 Jägerinnen und Jäger in Österreich zum Erwerb des Bleichmittels Wasserstoffperoxid ausverhandeln. Das Bundesministerium stellt in einem offiziellen Informationsschreiben vom 15. März 2021 fest, dass Jägerinnen und Jäger mit gültiger österreichischer Jagdkarte als „gewerbliche Verwender“ im Sinne des Art. 3 Z 9 der EU-AusgangsstoffV zu qualifizieren sind. Nach Auskunft der Apothekerkammer wurden alle Apotheken ebenfalls informiert. Das Bleichmittel Wasserstoffperoxid kann nun von Jägerinnen und Jägern für den Eigenbedarf unter Vorlage einer gültigen österreichischen Jagdkarte erworben werden. Wasserstoffperoxid ist sicher zu verwahren, sodass der Zugriff durch unbefugte Dritte verhindert wird.
„Diese pauschale Lösung erspart den Jägerinnen und Jägern die mühsame Einholung separater Genehmigungen zum Erwerb des Bleichmittels als auch den Behörden und Apotheken einen erheblichen Arbeitsaufwand zur Prüfung und Ausstellung der entsprechenden Papiere“, zeigen sich die Landesjägermeister erleichtert über die gute Übereinkunft mit dem Bundesministerium.
- Der Bezug von Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von über 12% erfolgt ausschließlich zum Zweck der Trophäenbleiche.
- Vorlage einer gültigen Jagdkarte
- Registrierung und Abgabe einer Kundenerklärung beim Bezug.In der Kundenerklärung sind der Verwendungszweck und die bezogene Menge Wasserstoffperoxid anzuführen. Die Erklärung ist bei jeder Transaktion abzugeben. Wenn jedoch die innerhalb eines Jahres getätigten Einkäufe nicht wesentlich voneinander abweichen, ist es ausreichend, die Kundenerklärung einmal jährlich zu erneuern. Der Wirtschaftsteilnehmer (z.B. die Apotheke) hat vor jeder Abgabe zu prüfen, ob es sich um denselben Verwender handelt, der bereits früher eine Kundenerklärung abgegeben hat. Auf der Kundenerklärung, die beim Wirtschaftsteilnehmer aufliegt, ist die im Zuge des Verkaufsvorganges abgegebene Menge des Wasserstoffperoxids einzutragen.
- Das Wasserstoffperoxid ist sicher zu verwahren und vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. Wir empfehlen die bereits bekannten Bestimmungen zur sicheren Verwahrung von Jagdwaffen künftig auch auf Wasserstoffperoxid anzuwenden.
- Jedes Abhandenkommen, oder ein Diebstahl ist umgehend der Polizei zu melden.
Nach Auskunft der Apothekerkammer wurden alle Apotheken ebenfalls informiert. Der Bezug unter den eben ausgeführten Voraussetzungen sollte daher ab sofort wieder problemlos möglich sein.
Bei Fragen stehe wir Ihnen gerne zur Verfügung.
„JAGD ÖSTERREICH“ ist der Zusammenschluss aller neun österreichischen Landesjagdverbände und vertritt die Interessen der rund 130.000 österreichischen Jägerinnen und Jäger auf nationaler und internationaler Ebene.